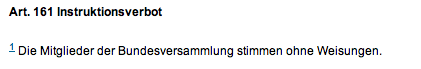Der amerikanische Wissenschaftsjournalist Chris Mooney, der erklärt, weshalb Menschen nicht an wissenschaftliche Erkenntnisse glauben, präsentiert in einem Essay auf MotherJones Auszüge aus einem Buch über das Denken der Republikaner –
The Republican Brain: The Science of Why They Deny Science – and Reality. Im Folgenden fasse ich seine Erkenntnisse kurz zusammen und beziehe sie auf die Situation in der Schweiz.
Dabei möchte ich zunächst anmerken, dass ich die Vermessung der schweizerischen Politik im Schema »rechts – links« für problematisch halte. Alle seriösen wissenschaftlichen Methoden führen weitere Dimensionen ein, die aber im öffentlichen Diskurs kaum je verwendet werden. Labels wie »bürgerlich« oder »liberal« zeichnen sich dadurch aus, dass sie ständig neu definiert werden. Mir scheint, gerade die Dimension »progressiv/offen – konservativ« verdiene mehr Beachtung. Tatsächlich ist die SVP z.B. in ihrer Staatsskepsis keine besonders bürgerliche oder liberale Partei, sondern letztlich eine konservative. Damit ließen sich einige Widersprüche erklären – z.B. das Festhalten an einer staatlichen Landwirtschaftsförderung und einer großen Armee, während man krampfhaft versucht, Staatsausgaben und Steuereinnahmen zu senken.
Um Konservative geht es Mooney. Er zeigt detailliert, dass politisch aktive Republikaner die Wahrheit bewusst ignorieren: Sei es in einem wissenschaftlichen, einem wirtschaftlichen oder einem historischen Kontext. So gibt es führende Republikaner, die nicht das nicht nur in Bezug auf die Klimaerwärmung und Obamas Geburtsort tun, sondern z.B. auch in Bezug auf die Relativitätstheorie, von der die Conservapedia, die konservative Ausgabe der Wikipedia, behauptet, sie sei experimentell widerlegt – unter anderem mit einem Verweis auf Bibelstellen.

Diese Ignoranz erklärt Mooney nun auf zwei Arten. Er hält zunächst fest, dass es sich nicht um eine Frage der Intelligenz handle, dass praktisch ausschließlich Republikaner an Phänomene glauben, die wissenschaftlich erwiesenermassen falsch sind. Die Gründe dafür, so Mooney, seien:
- Eine Phase der gesellschaftlichen Liberalisierung in den USA habe die Werte von religiösen Interessensgruppen bedroht. Die vehemente Reaktion dieser religiösen Konservativen habe dazu geführt, dass andere Gruppen innerhalb der Republikaner auf diese Stimmen angewiesen waren und sich mit ihnen verbündet hätten.
Gleichzeitig begannen viele Firmen die Republikaner mit Geld von ihren Interessen zu überzeugen, so dass wiederum ideologische Widersprüche, aber gemeinsame Interessen entstanden seien.
- Die bedeutsamere Konsequenz ist aber die psychologische: Konservativ werden Menschen, denen Stabilität wichtig ist, im sozialen, politischen und religiösen Kontext. Sie mögen Vertrautes und hassen neue Erfahrungen und Veränderungen. Wenn sie argumentieren, dann nicht, um der Wahrheit gerecht zu werden, sondern um das zu verteidigen, woran sie glauben: Ihre Familie, ihr »Stamm«, ihre Ideologie.
Diese psychologische Betrachtungsweise, so Mooney, ist die Schwäche der progressiven Politikerinnen und Politiker: Sie handeln so, als wäre es möglich, durch Argumente die Einstellung von Konservativen zu ändern. Für die wäre gerade eine Änderung ihrer Haltung psychologisch so etwas wie ein Verrat, ein Versagen.
Kehren wir zurück zur Schweiz. Die Tendenz, Fakten zu negieren, macht sich meiner Meinung nach auch hier breit: So wird z.B. im Fall Hildebrand heute noch von konservativer Seite aus so getan, als habe sich der ehemalige Präsident der Nationalbank gesetzwidrig verhalten – was nachweislich nicht der Fall ist. Als Beispiel eignet sich auch die Rechtsgleichheit: Die Vorstellung, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (oder sein sollen), ist eine aufklärerische – also eine progressive, linke Vorstellung. Sie ist nach allen Vorstellungen von Gerechtigkeit gerecht. Und dennoch gibt es viele Bereiche, in denen Konservative in der Schweiz diese Vorstellung ablehnen (Ausschaffungsinitiative, Einbürgerungen etc.).
Mooney Konsequenz wäre, dass man keine Energie darauf verschwenden sollte, Konservative argumentativ zu überzeugen. In Diskussionen über die Minarettinitiative hatte ich den größten Erfolg, wenn ich darauf verwiesen habe, dass die Minarettinitiative unschweizerisch sei. Dafür hatte ich ein paar gute Sätze und Begründungen bereit, auch wenn mir nicht klar ist, was »schweizerisch« bedeuten soll.
Die konservative Haltung zeigt sich in den drei berühmten Bürokratie-Maximen:
- »Das haben wir schon immer so gemacht!«
- »Das haben wir noch nie so gemacht!«
- »Da könnte ja jeder kommen.«
Wer darauf entgegnet: »Aber das sind doch keine guten Argumente!«, der verkennt, dass es auf gute Argumente nicht ankommt.
* * *
Nachtrag, 2. April 2012:
Beat Habegger wies mich in einer Diskussion auf Twitter darauf hin, dass die oben skizzierte konservative Haltung in verschiedenen politischen Lagern vorkommt:
http://twitter.com/#!/beathabegger/status/186558663819927552
http://twitter.com/#!/beathabegger/status/186553652364845056
Damit bin ich grundsätzlich einverstanden: Auch innerhalb der Schweizer Linken gibt es die Tendenz, gewisse Strukturen erhalten zu wollen und Argumente zu suchen, mit denen das gelingt. Damit geht die Bereitschaft einher, relevante Fakten auszublenden oder abzuschwächen.
Darüber hinaus zeigt die Diskussion mit Beat Habegger, dass in der konkreten politischen Praxis selten Fakten selbst Thema der Diskussion sind, sondern die Folgerungen aus der Betrachtung von Fakten eine Rolle spielen. Politische Forderungen sind dabei selten direktes Abbild eines Realitätsverständnisses, sondern immer auch mit anderen Haltungen, Überzeugungen und Annahmen vermischt.
Mooney hat aber direkt die Haltung in Bezug auf Fakten überprüft: Denken Menschen, Obama sei in Kenya geboren? Denken sie, Abtreibung sei eine Ursache von Brustkrebs? Denken sie, Mediziner seien der Ansicht, Abtreibung führe zu Brustkrebs? – Das sind Beispiele, bei denen sich klar angeben lässt, was die Wahrheit ist (wobei natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass man sich täuscht).
Fazit wäre: Konservative gibt es in allen politischen Lagern. Aber – das meine Behauptung – die konservative Rechte weist die größte Dichte an Argumenten auf, die nicht primär eine optimale Reaktion auf die Wirklichkeit beabsichtigen, sondern aus konservativen Überzeugungen resultieren.