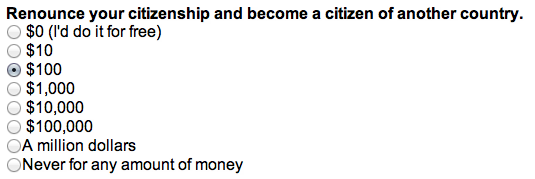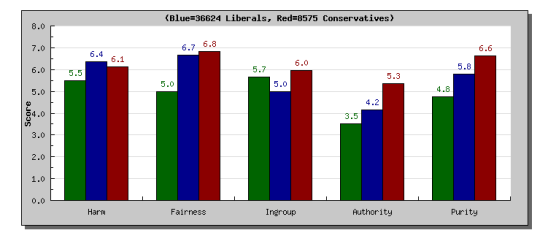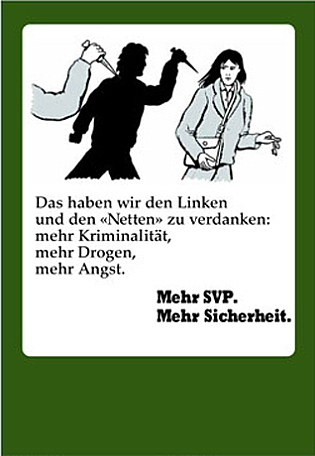Am Wirtschaftsforum Toggenburg, dessen Thema »Kommunikation« war, durfte ich dieses Jahr ein paar Gedanken zu Social Media präsentieren. Die anderen Referenten – für die Sachthemen waren leider ausschließlich Männer geladen worden – haben mich fast alle sehr beeindruckt: Besonders der ehemalige Bundesratssprecher Oswald Sigg, der im Gespräch mit Patrick Rohr seine Einschätzungen zur Bedeutung politischer Kommunikation in der Schweiz präsentierte. Ich fasse seine zentralen Aussagen im Folgenden zusammen und kommentiere sie anschließend kurz.
Sigg erzählte zunächst von Adolf Ogis legendärer Lötschberg-Rede (Neujahr 2000): »Die Tännli-Rede war das kommunikative Glanzstück Adolf Ogis«. Dies, obwohl alle Beraterinnen und Berater sowohl einen anderen Ort als auch einen anderen Inhalt vorgeschlagen hätten und Filippo Leutenegger von SF ins Bundeshaus anrief, um mitzuteilen, offenbar sei nur die Probeaufnahme angekommen in Leutschenbach, die richtige möge doch bitte nachgesendet werden. Das Echo, das Ogi erhielt, sei unerwartet gewesen – Tausende Emails, Kisten voll Briefpost, »98% positiv«.
Das Beispiel Ogi zeigt für Sigg, dass politische Kommunikation dann funktioniert, wenn Politik nicht verkauft werden muss. Heute seien die Kommunikationsstäbe des Bundesrates damit beschäftigt, für die Politik des Bundesrates zu werben. Sigg führt das auf das geringere Gewicht der Politik in den Medien zurück, das eine stärkere Selektivität und Zuspitzung erfordere. Die Politik reagiere so auf die medialen Veränderungen. »Heute geht niemand mehr davon aus, dass Politikerinnen und Politiker ehrlich kommunizieren.«
Dabei, so Siggs paradoxer Schluss, gerade das Eingestehen eines politischen Scheiterns oder eines Fehlers enorm zur Glaubwürdigkeit einer Politikerin oder eines Politikers beitragen. Das Gebot der Wahrheit sei eines, das man in der Politik nicht einfach ablegen könne und dürfe. Wer Dinge verschweigt, von denen er oder sie Kenntnis hat, wird heute unweigerlich über sie stolpern.
Und dennoch – hier beginnt mein Kommentar – ist dieses Stolpern in den meisten Fällen belanglos. In einer Analyse zum BVK-Debakel schreib der Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Zanetti im Tages-Anzeiger:
Im Begriff «Verantwortung» steckt das Wort «Antwort». Gemeint ist die Antwort, die jemand auf einen Vorwurf geben kann. […] Handelt es sich um eine der üblichen PR-Antworten der Politik, hat der Regierungsrat damit sein Versprechen gebrochen, offen und transparent zu kommunizieren. […] Verantwortung zu tragen, hängt auch nicht vom Verschulden ab. In einer Führungsfunktion bleibt jemand selbst dann verantwortlich, wenn kein persönliches Verschulden vorliegt. Wer führt, hat den Erfolg sicherzustellen. Und wenn stattdessen ein Misserfolg eintritt, hat er Verantwortung zu übernehmen.
Das scheinen mir sehr entscheidende Überlegungen sein: Politik muss – gerade von Exekutivmitgliedern – kommuniziert werden. Ehrlich und transparent. Dafür sind auch die Kommunikationsverantwortlichen dieser Regierenden angestellt, nicht für die Präsentation einer Person oder von Parteipolitik. (Sigg selber hat dann aber auch erzählt, wie er im Streit zwischen Samuel Schmid und Christoph Blocher Schmids parteipolitischen Interessen wahren musste). Verantwortung und Wahrhaftigkeit müssen – und das ist auch die Aufgabe der Medien – mehr Gewicht erhalten. Das ist aber auch deshalb schwierig, weil in Schlüsselbereichen die politische Kommunikation des Staates die Aufgaben der Medien übernimmt. So schalte er Kritik aus, meint Sigg: Die Abstimmungsbulletins sind umfassende Informationen, die aber letztlich bewirken, dass andere Medien sich zurückhalten und damit einen Diskurs verhindern.