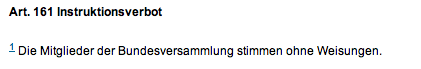Andreas Schürer schreibt in der NZZ:
Jetzt ist die Justizdirektion in der Defensive. Während sie einen auf Freitag angekündigten Bericht erarbeiten lässt, werden immer mehr Details über den Umgang mit dem 17-jährigen «Carlos» bekannt, der vor zwei Jahren in Zürich einen Jugendlichen niedergestochen und schwer verletzt hatte. Nicht nachvollziehbar ist, wie umfangreich das monatlich 29 000 Franken teure Programm für «Carlos» ausgestattet wurde und dass er auf Staatskosten von einem vorbestraften Thaibox-Trainer zum Profi ausgebildet werden sollte. Der Justizdirektor Martin Graf (gp.) ist mit dem ersten Ernstfall in seiner Zeit als Regierungsrat konfrontiert. Die Krisenkommunikation kann nur glücken, wenn er die Fehler in dieser Geschichte schonungslos benennt, fallbezogen Konsequenzen zieht und allgemeine Missstände im Umgang mit jugendlichen Gewalttätern ans Licht zerrt. Tut er dies in seiner angekündigten Stellungnahme nicht, fällt die Geschichte auf ihn zurück.
Diese Meinung vertreten viele Menschen: Das Programm ist zu teuer, es verwöhnt einen Straftäter und bildet ihn in einer Kampfsportart aus, wo er doch schon gewalttätig geworden ist.
Bezeichnend an dieser Passage ist die Aussage, es sei »nicht nachvollziehbar«, wie das Programm entstanden sei. Genau so geht es mir: Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich die Geschichte von »Carlos« nicht kenne, die Bemühungen der Behörden und Gerichte, ihn einer Therapie zuzuführen und zu resozialisieren. Ich kenne mich generell im Umgang mit jugendlichen Straftätern nicht aus, bin dafür nicht ausgebildet und kann keine kompetente Meinung vertreten. Ebenso verstehe ich nichts von Kampfsportarten und ihrem therapeutischen Einsatz bei einem jugendlichen Intensivtäter.
Meinungsfreiheit mag ich, staatliche Kontrolle von Meinungen lehne ich ab. Aber Freiheit, das ist schon fast eine Platitüde, bringt Verantwortung mit sich. Wer eine Meinung äußert, hat meiner Meinung nach die Pflicht, sich zu informieren, die Meinung zu begründen.
Nehmen wir ein Beispiel: 29’000 Franken kostet das Programm pro Monat.
- Wie viel kosten alternative Programme wie die geschlossene Psychiatrie?
- Was wird mit diesen 29’000 Franken genau finanziert?
- Kostet das Programm jeden Monat 29’000 Franken oder ist das Spitzenwert?
- Werden Kosten abgewälzt auf Verwandte von »Carlos«?
Wer diese Fragen nicht beantworten kann, darf natürlich finden, 29’000 Franken seien zu viel. Aber diese Meinung muss ich nicht ernst nehmen, weil sie mir nichts sagt. Zu viel im Vergleich womit? Mit dem Lohn einer Person, die arbeitet? Mit den Kosten, die »Carlos« verursacht, wenn er nicht therapiert werden kann? Mit anderen Unterbringungsformen?
Und zum Schluss ein Bekenntnis: Ich mag Expertinnen, ich mag Experten. Ich höre ihnen gerne zu, weil sie sich auskennen, weil sie Erfahrung haben und weil sie Alternativen aufzeigen können. Dass Expertinnen und Experten einen schlechten Ruf haben, ist ein Problem, das meiner Meinung nach viele negative Auswirkungen haben kann. Es ist richtig, die Öffentlichkeit transparent über den Strafvollzug, auch bei Jugendlichen zu informieren – aber nicht aufgehängt an Einzelfällen, sondern ein klares, präzises und breit abgestütztes Bild. Aber es ist nicht richtig, die Öffentlichkeit auf solche Prozess Einfluss nehmen zu lassen, wenn das nicht auf einem demokratisch abgestützten Weg passiert.